In Feuilletons und unter popkulturellen Meinungsführern wird in den letzten Jahren gemeinhin die These vertreten, dass durch verändertes Konsumverhalten (erst Pay-TV/Pay-Per-View, nun ganze Staffeln im Onlinestream) die Serie zu einer eigenständigen Kunstform herangereift sei, die immer mehr zu DEM Medium werde, in dem komplexe Geschichten und Charakterentwicklungen unserer Zeit am adäquatesten dargestellt werden können. Besonders gelobt wird, so etwa auch von Katharina Grosse im lesenswerten Kulturmagazin Postmondaen, der Verzicht auf geschlossene Episoden zu Gunsten einer staffel- oder serienübergreifen Erzählstruktur sowie das Wegfallen sogenannter Cliffhanger.
Roman in Bildern reicht nicht
Ich möchte dem entgegensetzen, dass die Serie als Kunstform aus genau den gelobten Gründen kurz davor ist ihren Zenit zu überschreiten (oder es schon hat), dass die Serie, die immer mehr versucht zum Roman epischer Breite in Bilder zu werden die Spezifik ihres eigenen Mediums schädlich negiert und am Ende Gefahr läuft als der Groschenroman des neuen Jahrtausends zwar sicherlich ihr wirtschaftliches Potenzial zu realisieren – auch Groschenromane verkaufen sich gut – aber das künstlerische Potenzial nie ganz.
Wieso? Man wird doch kaum bestreiten können, dass in den letzten 20 Jahren so viel gute Serien wie nie zuvor entstanden sind? Bestreite ich auch nicht. Die spätestens mit Seinfeld und Roseanne bereits mächtig begonnene Bewegung hin zu Multi-Episoden-Handlungsbögen und kritischer Selbstbezüglichkeit hat die Serie aus dem Immergleichen ihres unveränderlichen Universums hinaus katapultiert. Über Zwischenstationen waren hochdynamische Serienhits wie die Sopranos und The Wire die fast zwingende Folge. Die Kunst das eine spezifisch Serielle, die Eigenständigkeit der Folge – also eine komplexe Geschichte innerhalb von weniger als einer Stunde zu erzählen – mit dem anderen – einem Handlungsbogen epischer Breite – zu verknüpfen, das war das Neue, die prekäre Ballance, die das Erzählen in starken Serien fortan hätte ausmachen können. Beides sauber zu komponieren, das Kleine und das Große, und beides miteinander in Beziehung zu setzen ohne sich dabei zu verzetteln, das ist die Meisterschaft die einige der Serien des sogenannten „goldenen Zeitalters“ ausmachte, und obwohl hier noch viel Luft nach oben gewesen wäre (für gewöhnlich wird entweder das Eine oder das Andere eben doch vernachlässigt) – hier wurde zeitweise eine Perfektion erreicht wie sie etwa in der Literatur, im klassischen Fortsetzungsroman, mit dem man die moderne Serie gerne vergleicht, nicht einmal angestrebt wurde.
Einzelne Folgen vernachlässigt
Mittlerweile ist das Interesse an der kleinen Form Vergangenheit. Schon das hochgelobte Breaking Bad war im Großen und Ganzen eine sehr traditionelle Geschichte mit, abgesehen von der provokativen Prämisse, seeeeeeehr traditionellen Inhalten, deren Unterteilung im Kleinen vor allem noch durch eher willkürlich gesetzte Cliffhanger gesichert wurde. Und auch im Großen wird man dann schnell nachlässig: Hier strukturieren neben dem von Rushdie in der Literatur so treffend kritisierten „what happens nextism“ vor allem einige penetrant wiederholte Leitmotive das Ganze. In dem ebenfalls fürs Erzählerische gepriesenen Game of Thrones hält dann schon wieder praktisch nur noch die Frage wie es weitergeht zum Weiterschauen an – ablesbar auch an der Wut der Fans darüber wenn es nicht weitergeht wie erhofft. Nebenbei:
„Seit den frühen 90er Jahren ist Martin besonders für zwei Eigenheiten bekannt: eine hohe Komplexität des Narrativs sowie die Skrupellosigkeit im Umgang mit seinen ständig wechselnden Hauptcharakteren, die teilweise eine sehr kurze Lebensdauer haben“,
schreibt Martin Kulik ebenfalls bei Postmondaen. Ich widerspreche in beiden Fällen: Viel Stoff und Komplexität sind einfach nicht das gleiche. Und George RR Martin hat, vorausgesetzt dass Jon Snow noch am Leben ist, wofür bis heute alles spricht, noch nicht einen einzigen Hauptcharaktere um die Ecke gebracht. Er hat einfach die Kontrolle über ein ursprünglich in drei Teilen geplantes Buch verloren, weshalb einige Leser sich im Missverständnis darüber befinden, wer eigentlich die Hauptcharaktere sind.
Statt 2 – gleich 20 Stunden Mittelmaß?
Dass nun ganze Staffeln in einem Rutsch veröffentlicht werden befeuert diese Entwicklung, so viel ist an der Beobachtung richtig, natürlich noch weiter. Wenn Game of Thrones, House of Cards und andere neuere Exponate des Genres aber ein guter Gradmesser sind, wird das vor allem dazu führen, dass Autoren und Regisseure, denen es schon selten genug gelingt einen zweistündigen Film stringent zu entwickeln, sich nun bemüßigt fühlen 20-stündige Filme mit willkürlichen Brüchen zu drehen. Gewiss, auch dabei könnte ein stilistisches wie erzählerisches Meisterwerk herauskommen. Doch wahrscheinlicher scheint, dass wo der äußere Zwang zur Form fehlt, dessen konsequentes Ausfüllen und spielerisches Überschreiten das goldene Serienzeitalter eingeläutet hatte, ein innerer sich nicht einstellen wird. Schon allein weil der Markt ihn offenkundig nicht ausreichend nachfragt – die Anstrengung also nicht nötig ist.
In der zeitgenössischen Literatur gilt: Obwohl heute so viele schwache und mittelmäßige Texte produziert werden wie noch nie, entstehen auch jährlich zumindest von der handwerklichen Seite her so viele Meisterwerke wie früher in einem Jahrhundert nicht. Der Professionalisierung der Autorenschaft sei dank. Doch angesichts der Produktionskosten und dem damit einhergehenden sehr eingeschränkten Personenkreis professioneller Serienproduzenten würde mich in diesem Marktsegment eine ähnliche Entwicklung überraschen. Als erklärter Serienfreund lasse ich mich aber gern von der Zukunft widerlegen.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



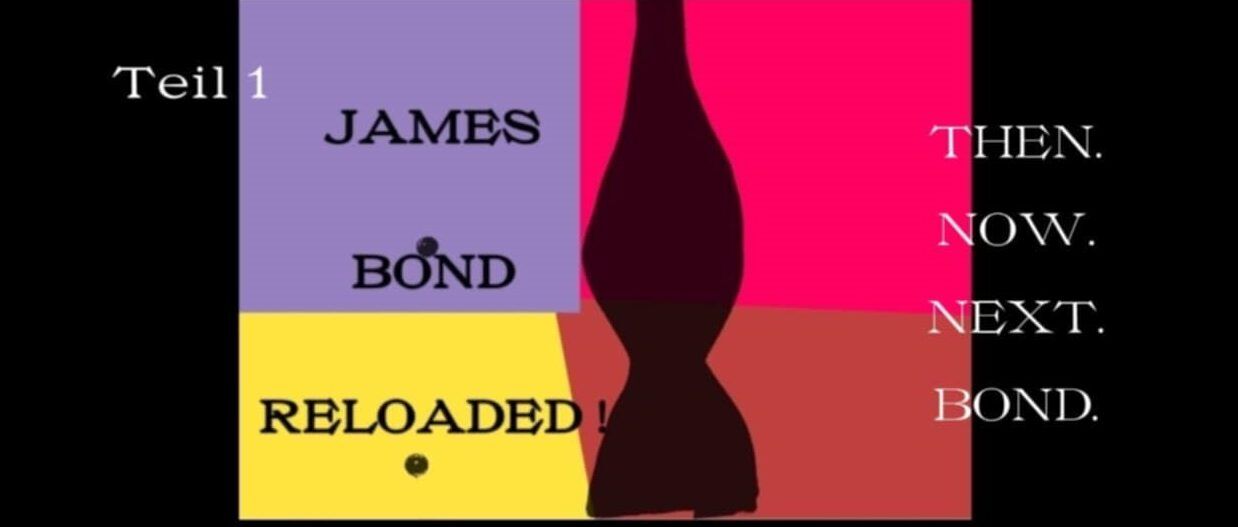
Andreas Kern
Unser „Lieblingsthema“ Game of Thores…Sind mit Ned und Robb Stark, Joffrey Baratheon und Tywin Lannister nicht doch einige Hauptfiguren gestorben? Und wirkte Jon Snow – zumindest in den ersten beiden Staffeln – nicht bloß wie eine Nebenfigur?