Über 60 Jahre Grateful Dead! Mittlerweile haben nahezu alle Gründungsmitglieder die Lichtung am Ende ihres Pfades erreicht. Nachdem nunmehr auch Bob Weir das psychedelische Gebäude verließ und ihr Frontman Jerry Garcia bereits 1995 die letzte Tüte rauchte, verbleibt Bill Kreutzmann als Last Man Standing.
Das schreit nach angemessener Würdigung.
Nur wie?
Bzw. wo denn mal andocken?
Dann sind wir ehrlich: trotz dieses großen Namens, ist der musikalische Output der breiten Masse nahezu unbekannt.
Bei der Frage: nenne doch mal deine drei Grateful Dead Lieblingslieder, achwas, nur eines, bleibt man relativ alleine im Regen stehen.
Dieser Umstand liegt darin begründet, dass sich the Grateful Dead im Grunde nicht an einen Konzept der Hitlisten oder der chart-klopper orientierten, sondern vor allem Stimmungen innerhalb der Songs ausloten, Facetten, welche mitunter psychedelisch komplett ausufern können.
Zunächst einmal benötigen wir mithin eine aussagekräftige Zusammenstellung, die den Begriff „Best of“ repräsentiert.
So richtig taugt von Dutzenden nur eine.
Die vorliegende Sammlung wird der musikhistorischen Bedeutung der Band in jeder Sekunde gerecht.
Grateful Dead – „The Best Of The Grateful Dead“ aus dem Jahr 2015
Der weltweit umfangreichsten Live-Diskografie aller Zeiten stehen nämlich lediglich 13 Studioalben gegenüber, die es gleichwohl in sich haben. Diese Periode von 1967 bis 1989 würdigt die Compilation mit insgesamt 32 Tracks. Heraus kommt ein musikalisches Filetstück der Sonderklasse. Von psychedelischen Pop-Perlen über ausufernden LSD-Rock bis hin zu einer echten Suite reihen sich vielfältige Edelsteine aneinander, die man Novizen wie alten Hasen bedenkenlos ans Herz zu legen vermag.
Ab geht es.
„The Golden Road (To Unlimited Devotion)“ und „Cream Puff War“ („The Grateful Dead“ 1967) belegen eindrucksvoll, wie weit man seiner Zeit bereits auf dem Debüt voraus war. Sie vereinen das große Talent für catchy Popmelodien mit herrlich verschrobener Psychedelik, die sich sonst fast nur bei den ganz frühen Pink Floyd noch mit Syd Barrett oder ähnlichem NLfindet. Besonders die Wahl von Soundhexer David Hassinger als Produzent (u.a. Jefferson Airplanes Meilenstein „Surrealistic Pillow“ samt Kulttrack „White Rabbitt“, oh ja.) zahlt sich für Grateful Dead hörbar aus.
Eine Sonderstellung nimmt der Song „Dark Star“ (1968) ein. Das knackige Stück erscheint lediglich als Single-Release und findet sich auf keinem regulären Album. Dennoch entwickelt es sich zu einer ihrer beständigsten Visitenkarten, die Grateful Dead live gern auf mehr als 30 Minuten Spielzeit dehnen. Besonders Bassist Phil Lesh liefert sich hier ein herrliches Ringen mit Garcias jazzy angeschlagener Axt.
Neben Jack Bruce von Cream ist Lesh weltweit einer der ersten Musiker überhaupt, der sich vom reinen Rhythmuskorsett befreit und bereits ab 1965 den Bass als melodisches Leadinstrument einsetzt.
Mit den beiden wichtigen Alben „Workingman’s Dead“ und „American Beauty“ (beide 1970) stellen sich die Dead auf eine Stufe früher Pioniere der Genrevermischung im Bereich Blues/Folk/Rock/Jazz. Berühmte Platten von Kollegen wie Van Morrison („Moondance“) oder der befreundeten Crosby, Stills, Nash & Young („Deja vu“) landen in der Gunst der Rolling Stones-Leserschaft im selben Jahr sogar hinter Garcia und Co. Das muss man erstmal schaffen.
Dabei entstehen Hits wie die hier vertretenen „Truckin'“ oder das großartige Mandolinenstück „Friend Of the Devil“ unter echten Survivalbedingungen. Nicht nur, dass ihr Manager die Truppe um 155.000 Dollar erleichtert. Der Dieb ist zu allem Überfluss auch noch der Vater von Drummer Mickey Hart. Die Liebe Familie, wir kennen es alle.
Gleichwohl sollten filigrane Folksongs dieser Phase sicherlich auch jeden Fan moderner Combos wie Fleet Foxes etc gewinnen.
Ganz anders kurz darauf das fast 20-minütige „Terrapin Station“ vom gleichnamigen 1977er Album. Mit klassischem Orchester lotet die famose Suite besonders Prog- und Artrock aus. Jeder Freund von early Genesis oder Yes sollte den Dialog der Streicher und Bläser mit Bill Kreutzmanns perkussivem Getrommel und Garcias glühenden Licks zu schätzen wissen. Es ist sogar noch sinnlicher als bei den britischen Kollegen. Denn dort wo yes und besonders die frühen Genesis immer etwas verkrampft asexuell verkopft wirkten, geht es hier auf der sinnlichen Ebene komplett ab.
Sogar schwächere Alben wie „Shakedown Street“ (1978) oder „Go To Heaven“ (1980) hinterlassen dank passend erwählter Melodic Rock Nummern wie „I Need A Miracle“ einen positiven Eindruck.
Dennoch steigert sich die Best Of zum Ende sogar um ein weiteres Mal. Das liegt vor allem an den drei Aushängeschildern ihres superben Spätwerks „In the Dark“ (1987). Keine andere Studioplatte der Leichentruppe kommt ihrem perfekten Livesound so nah. Kein Wunder! Für die Aufnahmen mieten die Perfektionisten kein Studio. Stattdessen simulieren sie im Marin County Auditorium einen kompletten Livegig mit Bühnen- und Lightshow und allem Drum und Dran. Nur ohne Publikum.
Klappt.
Das hört man besonders dem erdigen „Hell In A Bucket“ an. Doch ist es vor allem ihr Überhit „Touch Of Grey“, der sie „voll 80er“ ins kollektive Gedächtnis der deutlich jüngeren MTV-Generation brennt. Der selbstironische Clip avanciert mit seinen berühmten Skelettmarionetten mit Recht zu einem Klassiker der Musikvideokunst. Auch in Deutschland landet der Song in der heavy rotation und mausert sich zum Hit.
So flicht „The Best Of The Grateful Dead“ der Legende aus San Francisco einen angemessenen Lorbeerkranz voll musikalischer Höhepunkte und schließt so das letzte Kapitel ihres kalifornischen Totenbuches.
Komplett?
Ah, nicht komplett natürlich.
Lediglich alle Studio-Aufnahmen.
Was fehlt?
Genau, ein richtiger Live-Klopper.
Und zwar dieser:
The Grateful Dead – „Live/Dead“ 1969
Der eine Meilenstein für Grateful Dead? Die Nadel im Heuhaufen? Kein leichtes Unterfangen. Immerhin ließ sich die Band um den schillernden Frontman Jerry Garcia nie stilistisch festlegen und glänzte in etlichen Genres wie Psycedelic Rock, Folk Rock/Americana, Progressive Rock und Classic Rock gleichermaßen. Doch es wird noch komplizierter: Obwohl etliche Studioalben tolle Zeugnisse ihrer Ära sind, gelang es GD nie, per Tonkonserve jenen berückenden Spirit und letzten Kick einzufangen, den ihre ausufernden, weitgehend improvisierten Gigs versprühten.
Der perfekte Meilenstein kann mithin nur eine ihrer zahllosen über 100 Liveplatten sein. Mit ihrer ersten Konzert-Doppel-LP „Live/Dead“ zündeten sie 1969 einen ganz großen Joint an. Kommerziell betrachtet winkte hiermit endlich der längst verdiente Erfolg. Musikhistorisch wie popkulturell handelt es sich um eine der bedeutendsten Liveplatten der Sechziger. Sogar medial erkannte man schon damals das Klassikerpotential als Manifest des Psychedelic Rock.
San Francisco, Fillmore West am 2. März 1969: Publikum und Band stehen einander in fast andächtiger Stille gegenüber. Wie bei vielen Shows jener GD-Phase gibt es im Zentrum des jeweiligen Konzerts ein aus Protest gemachtes Requiem für die Toten des Vietnamkriegs. „Death Don’t Have No Mercy“ umarmt alle Opfer und setzt ein Zeichen gegen Krieg und dessen Grauen. Dass Garcia samt Band ebenso high sind wie ihr Publikum, trägt zur Intensität des Geschehens beträchtlich bei. Besonders den Dialog zwischen Garcias Sologitarre und Tom Constantens Orgel sollte man nicht verpassen. Zehn Minuten lang wabert dieser todtraurige Blues durch die Halle und lässt kein einziges Auge trocken zurück.
Um dieses Auge des Sturms wirbelt ein psychedelischer Trip zwischen feinsinniger Lavalampe und zupackender Derbheit. Alles entstanden aus etlichen, mehrstündigen, bekifften Gratiskonzerten im Szeneviertel Height-Ashbury – genannt ‚Hashbury‘. Hier wurden GD – besonders Jerry Garcia – und die eng befreundeten Jefferson Airplane – vor allem Grace Slick – zu Galionsfiguren der Gegenkultur.
Schon der 23-minütige Opener „Dark Star“ bündelt alles, was Grateful Dead auszeichnet. Die Nummer ist ihr ultimativer Kultsong, gestartet 1968 als knapp dreiminütige Non-LP-Single. Wer diese Urversion hören möchte, greife zu einer „Live/Dead“-Edition, die den Track als Bonus beifügt. Die Musik stammt von Garcia. Der Text von Lyriker Robert Hunter, der zwar etliche ihrer Songs in Worte fasste, aber niemals auf der Bühne zu erblicken war.
Bemerkenswerterweise leidet dieser himmlische Spacetrip nicht unter seiner Länge. Was viele an gedehnten Jazz- oder Prog-Improvisationen als verkopft bis nervtötend masturbativ empfinden, existiert nicht.
Jedes Instrument arbeitet für den ultimativen emotionalen Ausdruck. Das Ergebnis: Hohe Komplexität ohne nennenswerte Anstrengung für den Hörer als virtuose Cannabis-Klangreise. Bob Weir gibt mit seiner Rhythmusgitarre den spröden Kontrast zu Garcias gleitender Lasergitarre. Bassist Phil Lesh wirbelt viersaitige Melodien hinzu.
Zur Krönung setzen diese quicklebendigen Toten als erste Formation auf den simultanen Einsatz zweier (!) Drummer. Bill Kreutzmann und Mickey Hart geben einander wechselseitig per Trommel und Percussion den Beat in die Hand. Ein „Drums“ bezeichneter Solopart beider fiel hier leider der Schere zum Opfer, da dieser das damalige Doppel-LP-Format gesprengt hätte.
Ähnlich ausgelassen, dabei weit offensiver, geht es auf „Turn On Your Love Light“ zur Sache. Im Original ein Rhythm & Blues-Klassiker Bobby Blands von 1961, wächst die Nummer hier zu einem viertelstündigen Monster. Neben GDs Bluegrass-Wurzeln hört man hier auch ihre Leidenschaft für Gospel. Garcia brüllt sich im Verlauf immer mehr in Ekstase und pendelt geschickt zwischen gedimmtem Verführer und flippendem Veitstänzer.
Am Ende des Gigs bleibt man bewegt zurück und tut es unwillkürlich Jerry Garcias Motto gleich: „Nothing left to do but smile, smile, smile.“
Was bleibt als offen Frage?
„OK, OK, aber Jery Garcia ist bereits seit über 30 Jahren tot. Wie hat die Band es denn ohne ihn und sein Charisma geschafft nicht unterzugehen?“
Dies zu begreifen, machen wir den Sack doch damit so richtig zu, dass wir uns ein spätes Konzert nehmen im direkten Maßstab des Vergleichs. Und zwar nicht irgendein Konzert, sondern ihr chronologisch allerallerletztes Happening, den Final Gig 2015.
The Grateful Dead – ,“Fare Thee Well“ (2015)
Das fühlte sich vor gut 10 Jahren in etwa so an:
Ein halbes Jahrhundert lang wandeln die Grateful Dead unter den Sterblichen. Nun fällt für sie der letzte Vorhang. Einmal noch machen sich Bob Weir, Phil Lesh und Co. auf, den Deadheads und dem gesamten Universum ihr ganz eigenes Gebräu aus Rock, Blues und Psychedelic zu servieren. Fünf lange Marathon-Konzerte spielten die Zombies im Sommer. Dies hier ist ihr letzter Gig.
Für immer.
Das Ergebnis fällt erwartungsgemäß grandios aus.
Auch ohne ihren charismatischen Frontman Jerry Garcia machen The Dead auf der Bühne eine ausnehmend gute Figur. Sie waren und sind Zeit ihres gesamten Bandlebens ein Kollektiv mit vielen kreativen Schultern.
Besonders den musikalischen Anteil Weirs und Leshs kann man nicht hoch genug einschätzen. So konnte es nach dem Zerbrechen ihrer Schicksalsgemeinschaft kein weiteres Studioalbum geben, klar. Ohne Garcia wäre ihnen dies nach eigenem Bekunden als Frevel und unwürdig fleddernder Kommerzkram erschienen. Live jedoch entfachen sie mit dieser Reunion noch einmal den Zauber ihres umfangreichen Katalogs.
So bietet das Abschiedskonzert einen magischen Trip durch fünf Dekaden.
Das popkulturelle Interesse an dieser einmaligen Wiedervereinigung nahm in den Staaten nahezu surreales Ausmaß an. Führte man hier das Wort „Blockbuster-Event“ im Mund, es wirkte fast wie eine Untertreibung. Um dem immensen Andrang Herr zu werden, gab es neben den reinen Konzerttickets zahllose Kinos, die eine Übertragung boten, sowie improvisierte Riesenleinwände im ganzen Land. Außerdem stellten YouTube, diverse Radiostationen, Streamingdienste und TV-Sender die Show zeitversetzt zur Verfügung. Sogar für das Superbowl-gestählte amerikanische Showbiz war das Ereignis ein Novum.
Zur Krönung erfahren The Grateful Dead Anerkennung von höchster Ebene. Behandelte man Garcia und Co. jahrzehntelang als eine Truppe subversiver Tunichtgute und Staatsfeinde, gab es für dieses rauschende Finale sogar eine Botschaft aus dem Weißen Haus. Präsident Obama persönlich gratulierte zum 50. und würdigte Grateful Dead als Ikonen amerikanischer Kreativität und Leidenschaft. Die Band nahm also den Joint zur Hand, das ganze Tamtam drumherum recht ungerührt zur Kenntnis und lief unbeeindruckt zur musikalischen Hochform auf.
Ihre überbordende Spielfreude fließt auch 20 Jahre nach offizieller Auflösung ungehemmt. All ihre Besonderheiten und typischen Kennzeichen rollen die Final Dead lässig als prächtigen Teppich aus. Das ‚Rhythm Devils‘ genannte Duo aus Mickey Hart und Bill Kreutzmann baut ein Fundament aus Beats und Percussion („Drums“). Was obig bei „Live/Dead“ mithin noch rausgeschnitten wurde, kann man sich in diesem Gig endlich mal in Ruhe zu Gemüte führen: Ihr Filigranes Gewiter.
Lesh wird seiner musikhistorisch bedeutsamen Rolle als einflussreicher Bass-Innovator gerecht. Auch in dieser Show emanzipiert er sich oft und gern von Gitarre und Trommeln und gibt den Ton an. Die Gitarrenarbeit teilen sich derweil Weir und Gaststar Trey Anastasio von Phish. Als Edeljoker glänzt zudem Bruce Hornsby, der Grateful Dead bereits auf der 1991er Tour begleitete.
Spieldauer und Setlist schöpfen erwartungsgemäß aus dem Vollen. Der Gig fährt fast dreieinhalb Stunden reine Spielzeit auf. Dabei zelebrieren die Greateful Dead eindrucksvoll jene ausufernde Lust spontaner Improvisation, die ihren Ruf als eine der weltbesten Live-Acts aller Zeiten zementiert. Das blinde Verständnis untereinander und die sensitive Fähigkeit aller, auf plötzliche Einfälle eines Einzelnen sofort weiterentwickelnd einzugehen, fasziniert auch heute noch ungebrochen.
Die Songs selbst spannen dabei einen weiten Bogen. Vom Endsechziger Psychedelic-Bonbon „Space“ oder „China Cat Sunflower“ über das 70er Artrock-Highlight „Terrapin Street“ bis hin zu späten Hits à la „Touch Of Grey“. So decken sie fast alles ab, was das Herz begehrt. Lediglich ihre eigentlich unverzichtbare Visitenkarte „Dark Star“ fehlt unverständlicherweise im Programm. Doch was bedeutet schon so ein Wermutstropfendes Mini-Detail in Ansehung eines solchen Konzerts?
Der Clou: man bleibt genauso bewegt zurück, wie nach dem obigen Gig anno ’68.
Ist jetzt alles gesagt?
Fast.
Erlaubt mir bitte eine persönliche Notiz zum Ende.
Mein persönlicher Grateful Dead Moment? Das war vor einigen Jahren, als ich anlässlich ihres Abschiedskonzertes kurz in Kontakt kam.
Nicht direkt. Das leider nicht.
Doch anscheinend gefielen ihnen – Weir und Kreutzmann insbesondere – die paar krummen Zeilen, die ich bis dato über sie verfasst hatte. Kurz nach Veröffentlichung diess Gigs und der Review dazu, finde ich bzw. Zizino, meine Frau, im Briefkasten ein wundervolles T-Shirt exakt in meiner Größe mit dem legendär skelettierten Bandlogo.
Dazu ein Zettel mit Widmung und Dankeschön für meine Sichtweise auf ihre Musik. Das wäre nicht so oft passiert.
Was für ein persönlicher Highlight-Moment für mich. Echter Ritterschlag im Grunde. So rede ich mir das in Eugenbewertung jedenfalls ein, tja.
Aber Latte.
Die Pointe liegt nämlich ganz woanders und ist deutlich weniger peinlich selbstreferentiell.
In einem eigentlich sehr typischen Anfall von
„Man muss die gute Energie weitergeben, sollte sie nicht für sich selbst horten. What ye cling to, ye will fukkin‘ lose, eh?“
verschenkte ich dieses unwiederbringliche Kleinod an einen Mann, der sich damals über einen längeren Zeitraum als scheinbar sehr guter Freund präsentierte, nur um hinterher, gar nicht so sehr mich, sondern sich gegenüber meiner Frau, Zizino, wie ein echter Arsch zu verhalten, schlimmer noch: wie ein nichtswürdiger Lappen.
Sollte ich mich nunmehr grämen?
Sollte ich in Groll verharren und denken: „da hat ja nun mal der ganz und gar falsche Typ von den positive Vibrations der Süßen profitiert.“
Ach nein.
Hauptsache, es ist überhaupt passiert. Alles andere muss man hinterher einfach auch loslassen können.
Alles andere?
Nun vielleicht doch nicht ganz und gar alles andere. Ihr Musik bleibt, ihr Kunst, sie bleibt und diese unfassbare Geschichte dieser Handvoll freundlicher, herzensguter Exzentriker, sie bleibt selbstverständlich auch von hier bis in alle Ewigkeit.
From Hamburg with Love
UK
PS. Alter nee, so kann ich diesen Artikel nicht beenden. Kann nicht mit mir aufhören es geht irgendwie nicht klar. Dafür gibt es hier noch viel zu wenig Jerry Garcia im Artikel.
Aber ihr wisst ja, ich glaube euch eure Zeit nicht. Der Song tippt ja jetzt kommt hat es wirklich zum Schluss noch einmal richtig in sich.
Kaum jemand steht nämlich – neben der lebenslangen Freundin Grace Slick von Jefferson Airplane – so sehr für die Gegenkultur der San Francisco Height Ashbury Szene, für die Hippies, für Freiheit, Liebe und Kunst. Die LSD-Gigs der Grateful Dead im Hause Ken Keseys („Einer Flog Über Das Kuckucksnest“), als das Zeug noch legal war, sind legendär und waren ihrer Zeit musikalisch deutlich voraus.
Doch jenseits der Kultfigur und des popkulturellrn Symbols „Jerry Garcia“ wird oft übersehen, was für ein unfassbar brillanter Gitarrist dieser freundliche, in sich ruhende und sehr sanfte Schöngeist aus Palo Alto war. Die richtigen Vorbilder hatte er sich in seiner Jugend mit Django Reinhardt oder Wes Montgomery bereits gesucht und gefunden. Besonders den Einfluss des letztgenannten hört man auf diesem Solostück recht deutlich.
„Love Scene“ ist ein Highlight auf dem ohnehin brillanten Soundtrack zu Michelangelo Antionis „Zabriskie Point“. Antonioni („Bow Up“) war so begeistert von Garcias Ausdruck und dessen Fähigkeit, während des Spiels simultan zu komponieren, zu improvisieren und alles augenblicklich notendruckreif heraus zu lassen, dass er ihn gleich mit zwei Tracks in den Film aufnahm. Neben diesem Lied findet sich auch noch Grateful Deads Übersong „Dark Star“ auf dem Album.
„Love Scene“ hingegen ist ein durch und durch romantischer Edelstein. Das Juwel zeigt Garcia, wie er mit sich selbst ein Duett spielt. Beide spontan hintereinander eingespielten und gegeneinander gesetzten Gitarrenfiguren greifen einander wie Zahnräder. Dabei gelingt es ihm, schwingende Psychedelik, das Gefühlt der Liebe und die staubtrockene Landschaft des Death Valley (Handlungsort des Films) gleichermaßen ein zu fangen.
Ich wage die These, dass dieses Stück in Sound und Ausdruck das mittlere Glied einer Kette großer Gitarrenindividualisten verkörpert, die mit Django/Wes beginnt, von Garcia hier weiterentwickelt wird und schlussendlich in Viny Reillys Postpunk-Gitarrengeklingel der Durutti Column kulminert. Doch solch nerdy Musikhistorikertum ist vollkommen unwichtig für den Genuss dieser Miniatur.
Nu‘ is aber wirklich Schluss.
+++
Lesen Sie auch: Zwischen zwei Zügen – eine Kolumne für David Bowie
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.




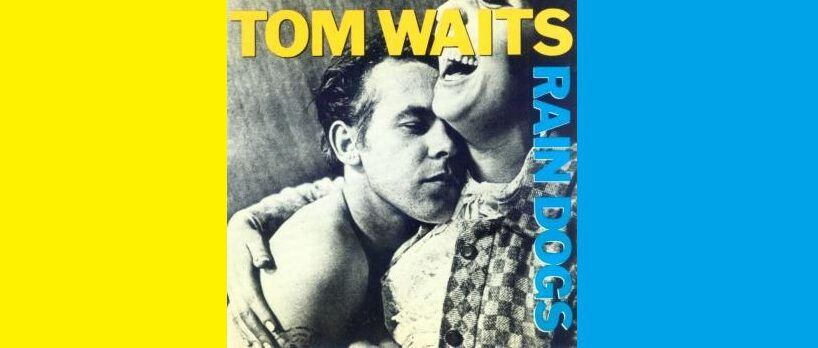

Ihr Kommentar