»Wie geht es dir?«, frage ich.
»Scheiße«, antwortet er.
»Siehst auch Scheiße aus«, sage ich.
Unser letztes Treffen liegt zehn Jahre zurück, kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Damals war Heinz noch in guter Form gewesen, Kurzhaarschnitt, akkurat rasiert, frisch geduscht, sonnengebräunt, strahlend weiße Zähne. Heute ähnelt er einer Figur aus einem Hollywood-Zombie-B-Film: abgemagert, struppige Frisur, löchriger Bart, maximal noch ein Dutzend Zähne, und die braun verfärbt, gelbe Gesichtshaut, blutunterlaufene Augen und dem Geruch nach zu urteilen, der von ihm ausströmt, hat er seine Notdurft nicht mehr völlig unter Kontrolle.
»Kannst du mir nen Zwanni leihen?«, fragt er.
»Ich hab dir was mitgebracht«, sage ich und drücke ihm einen Nullzweier-Flachmann in die Hand.
»Sehr aufmerksam von dir«, sagt er, dreht den Verschluss auf, setzt die Flasche an den Mund und kippt die Hälfte des Inhalts auf ex. »Das tut gut. Besser als all die Pillen«, seufzt er zufrieden und lässt dabei den Schnaps unter der Bettdecke verschwinden. »Die sind so neugierig hier, sagt er, »kein Bock darauf, dass sie den Fusel finden und einkassieren.«
»Sind die so schlimm wie in der Klinik?«
»Hängt davon ab, welche Schwester gerade Dienst tut.«
Letzte Station Sterbehospiz. Dort ist Heinz nach zwanzigjähriger Odyssee gelandet.
Fata Morgana der grenzenlosen Freiheit
Als ich Heinz vor zehn Jahren in der Geschlossenen kennenlernte, schwärmte er mir vom ungebundenen Leben draußen auf der Straße vor. Obwohl er sicher Raubbau an seinem Organismus betrieb, war das dem gepflegten Äußeren nicht anzumerken. Er machte den Eindruck eines durchtrainierten Sportlers auf mich und entsprach überhaupt nicht dem Bild, das ich von einem Penner im Kopf hatte. Im Laufe der folgenden drei Wochen freundeten wir uns an, er infizierte mich mit seinem pausenlosen Gerede von der absoluten Freiheit, die man nur dann erfährt, wenn man alle Brücken hinter sich abreißt und den bürgerlichen Konventionen Lebewohl sagt, und so folgte ich ihm nach absolvierte Entgiftung in den Park, den er sein Zuhause nannte. Es war Sommer, alles schien leicht und unbeschwert. Heinz lehrte mich die Kunst, mit geringsten Barmitteln zurechtzukommen, brachte mir bei, Schnaps und Zigaretten zu organisieren und an die anderen, weniger Geschickten, weiter zu verticken, ging mit mir zur Caritas, wo wir uns für einen Euro sattessen und für 50 Cent duschen konnten. Von der Natur überreich versehen mit Sexappeal, ruppigem Charme und einer nie nachlassenden Libido, war Heinz zudem erfolgreich bei den Frauen, von denen er jede Menge kannte und bei denen er bei Bedarf auch übernachtete. Er ließ mich dann alleine im Park zurück, verabschiedete sich mit den Worten: »Ich hab dir alles gezeigt und beigebracht. Jetzt musst du endlich auf eigenen Füßen stehen«. Ich wollte mir meine leichte Angst auf keinen Fall anmerken lassen und antwortete: »Klar kann ich das. Wir sehen morgen. Viel Spaß mit der Alten. Vögel sie für mich mit.«
Das Leben draußen ohne Heinz war jedoch ein anderes als mit ihm an meiner Seite. So wie ein älterer Bruder aus Pflichtgefühl heraus auf den jüngeren aufpasst, auch wenn er keine Lust darauf verspürt, so achtete Heinz stets darauf, dass mir nichts zustieß. Denn die Gefahren, die auf der Straße lauerten, waren mannigfaltig: Prügeleien wurden wegen fünf Euro oder einer halben Pulle Doppelkorn vom Zaun gebrochen. Selbst um die Schlafplätze unter den Brücken oder auf den Bänken entbrannte oft Streit. Ständige Polizeikontrollen und Abtransport entweder in die Ausnüchterungszelle oder ohne Umweg in die Klinik. Heinz als ungekrönten König der Stadtindianer focht das alles nicht an, niemand hätte je gewagt, sich ihm ohne vorherige Einladung zu nähern. Aber ich auf mich alleine gestellt musste mich, sobald mein Mentor sich in fremden Betten vergnügte, doch häufig meiner Haut erwehren. Gestohlen wurde alles, was man nicht an Bauch und Oberschenkeln festgetackert hatte. Schuhe, nachts ausgezogen, waren am nächsten Tag weg. Dass man, während man schlief, von den anderen gefilzt wurde: keine Seltenheit. Als die Abende im Oktober langsam kalt wurden, mein Rücken eines Morgens schmerzte, als ob ihn nachts jemand mit einem Baseballschläger bearbeitet hatte und Heinz seit drei Tagen spurlos verschwunden war, beschloss ich das Absolute-Freiheit-Experiment abrupt zu beenden. Meine Sehnsucht nach einer warmen Behausung mit fließendem Wasser und weicher Matratze war doch stärker als der Wunsch nach grenzenloser Unabhängigkeit. Heinz hätte mich einen undankbaren Bastard und ein notorisches Weichei genannt, aber der war seit 72 Stunden unauffindbar und mir wäre es in diesem Moment eh schnurz gewesen, was er von mir hielt. Nur raus aus dem Park und zurück in die bürgerliche Welt. Seit diesem Oktober vor zehn Jahren waren wir uns nie mehr über den Weg gelaufen.
Wiedersehen nach zehn Jahren
Und nun sitze ich hier auf einem roten Plastikstuhl gegenüber dem Krankenhausbett, auf dessen Rand Heinz hockt. Oder, um es konkret auszudrücken, das was von Heinz noch übriggeblieben ist. »Hallo«, hatte er vorgestern Abend am Telefon gesagt, »erkennst du meine Stimme?«
»Klar tue ich das. Woher hast du meine Nummer?«
»Frag nicht so dumm. Wenn ich was erfahren will, dann komme ich an jede Information ran … Zeit, einen alten Mann im Sterbehospiz zu besuchen? Und bring was mit. Du weißt, was ich meine.«
»Ich werde kommen«, sagte ich und legte auf.
»Wo hast du die zehn Jahre gesteckt?«, frage ich.
»Hier und da. War viel unterwegs, bin sogar bis Hamburg gekommen«, sagt er und leert die zweite Hälfte des Flachmanns. »Scheiß kleine Pulle. Warum hast du keine richtige Flasche mitgebracht?«
»Weil ich die kleine im Stiefel verstecken konnte.«
»Mach dir da mal keinen Kopf drum. Ist ein Sterbehospiz und keine Entzugsklinik. Ob ich am Krebs, der mich von innen auffrisst, zugrunde gehe oder am Schnaps: welchen Unterschied macht das? Fest steht: in ein paar Wochen werde ich Geschichte sein … schau nicht so belämmert. Irgendwann treten wir alle ab. Ich hatte eine schöne Zeit, bereue nichts.«
»Na dann«, sage ich.
»Okay, die letzten Jahre waren nicht mehr so gut. Ich wurde allmählich zu alt für diese Art Leben: zu langsam beim Beschaffen, zu schwach beim Verhandeln mit den Abnehmern, ständig pendelnd zwischen Bau, der Geschlossenen und Resozialisierungsmaßnahmen, obwohl ich nie resozialisiert werden wollte.«
»Dafür hast du dich erstaunlich lange gehalten«, sage ich, »andere, die es nur halb so haben krachen lassen wie du, liegen schon lange auf dem Friedhof.«
»Auch der schöne Manni?«
»Den hat’s vor acht Jahren zerrissen: Überdosis Dreckszeug auf der Caritastoilette.«
»Manni war eh immer ein Idiot. Konnte Rattengift nicht von Schore unterscheiden … und Lisbeth? Jetzt sag bloß nicht, dass auch Lisbeth nicht mehr da ist.«
»Die hat’s erwischt, kurz nachdem du die Stadt verlassen hattest. Lag eines Morgens mit schwarz angelaufenem Gesicht in der Gartenlaube ihrer Eltern.«
»Oh, Lisbeth auch. Scheiße, Scheiße, Scheiße … und Kurt?«
»Sie sind alle lange tot. Du bist der Letzte von damals, der übriggeblieben ist.«
»Und du«, sagt Heinz und sein Gesicht nimmt dabei für einen Augenblick denselben lauernden Ausdruck ein wie damals im Park, wenn es um das Verteilen der Tagesbeute ging. »Bist jetzt Abstinenzler und fleißiger Betbruder bei den AAs geworden … ich habe dir nie richtig über den Weg getraut. Hast das Ganze ja immer als Experiment angesehen und uns als deine Studienobjekte missbraucht. Du bist ein elender Heuchler, nichts anderes bist du.«
»Leck mich«, sage ich, stehe auf, Heinz klammert sich mit knochriger Hand an meinem Arm fest: »Du wirst doch wiederkommen, oder?«
»Was ist mit deiner Familie?«, frage ich, »du hast doch ne Exfrau und einen Sohn. Hast du mal Kontakt mit denen aufgenommen?«
»Ich will die auf keinen Fall hier haben.«
»Heinz, in ein paar Wochen bist du tot. Willst du die kurze Zeitspanne nicht nutzen, dich mit den beiden auszusprechen und zu versöhnen?«
»Ich möchte nicht, dass sie mich in diesem elenden Zustand sehen«, antwortet er und wirkt mit einem Mal nicht mehr energisch, sondern zerbrechlich.
»Kann ich verstehen«, sage ich und gehe.
Am Ende eine Mini-Beerdigung
Zwei Besuche und vier Flachmänner später war Heinz tot. Am vorletzten Abend erfolgte noch eine kurze Begegnung mit dem Sohn, die überwiegend schweigend verlief, denn die beiden wussten sich nach zwanzig Jahren Trennung nichts mehr zu sagen. Die Exfrau wollte ihn partout nicht mehr sehen, erklärte sich aber bereit, für eine kleine Beerdigung zu sorgen, die eine Woche danach an einem nasskalten Januartag auf dem Westfriedhof stattfand. Das letzte Geleit gaben ihm ein Priester, denn Heinz war nie aus der Kirche ausgetreten, der Sohn, ein Pfleger aus dem Hospiz und ich. Nachdem der Sarg nach unten gesenkt worden war, schüttelten wir uns stumm die Hände und gingen unserer Wege. Unspektakuläres Ende des langjährigen Königs des Parks.
Womit Heinz sich seine Brötchen vor der Odyssee verdient hat, wollen Sie noch wissen? Er war Steuerberater mit eigener Kanzlei und ausgeprägtem Hang zu Wein und weiblichem Büropersonal gewesen, bis ihm eines Tages Ehe und Job um die Ohren flogen und er beschloss, sein Leben von Stund an komplett umzukrempeln und ab sofort Platte zu machen. Dass er das Nomadentum zwanzig Jahre durchhielt, ist primär auf seine naturgegebene robuste Gesundheit bei gleichzeitiger Vorsicht, die ihn davon abhielt, sich dreckiges Zeug wie Manni reinzupfeifen, zurückzuführen. Den Rest seiner früheren Truppe erwischte es sehr viel früher als ihn.
Nachtrag: 52.000 Menschen vagabundieren in Deutschland dauerhaft auf der Straße. Nicht alle „freiwillig“ wie Heinz, dessen Freiwilligkeit bei nüchterner Betrachtung auf seinem Unwillen, sich mit Insolvenz und Scheidungskrieg auseinanderzusetzen, gründete. Gegen ein bürgerliches Leben in Wohlstand und Polyamorie hätte er nichts einzuwenden, wie er mir abends am Lagerfeuer manchmal erzählte. Aber der Mühe, Schulden zu tilgen und ein bescheidenes Dasein als schlecht bezahlter, angestellter Buchhalter zu fristen, wollte er sich auf keinen Fall unterziehen. Und so wählte er in letzter Konsequenz den Weg des Komplettausstiegs. Ob er diesen Schritt hin und wieder bereute? Mit hoher Wahrscheinlichkeit: ja. Aber Heinz war zu stolz, das jemals zuzugeben. Seit Januar sind es also 52.000 minus einer, die ohne festes Dach über dem Kopf bei Wind und Wetter im Freien hausen. Kluge Programme, sie von dort wegzuholen, sind bisher Mangelware.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



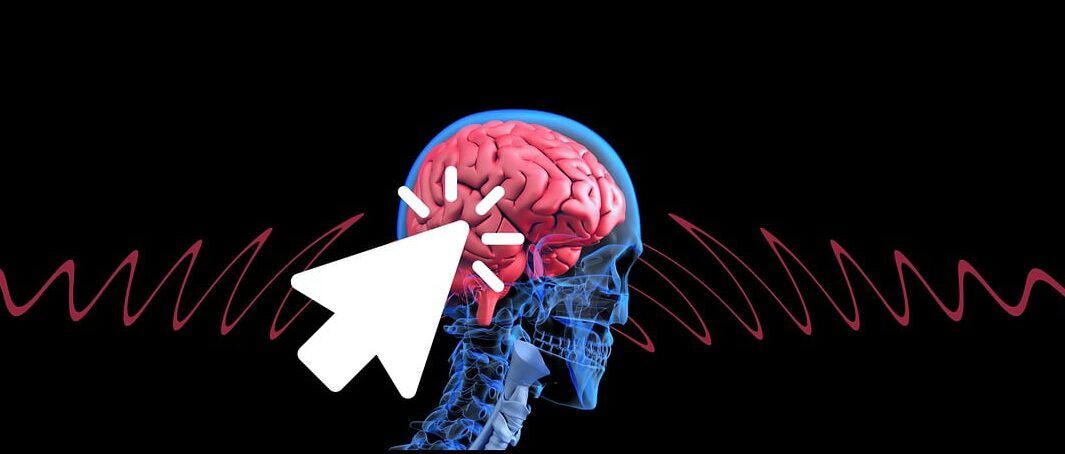

Ute Quabeck
Als ich mit Ihrem Geschwurbel durch war, habe ich geschurzt* und blieb so noch eine Weile gedankenverloren in der Sofaecke sitzen. Da dämmerte es mir, wie dies doch eine perfekte Metapher für Ihr Leben sei, Herr Hirsch.
* https://www.youtube.com/watch?v=mecj0ypvbZ4