»Noh Jodesbersch kanns do nit mih fahre«, sagt Jupp.
»Warum das denn?«, frage ich.
»Es en Nu-gu-Veedel jewode.«
»Woher stammt diese Information?«
»Hann ich vürgester Ovend am Stammdesch jehürt. En Trauerspill, dat mir No-go jetz och bei uns han.« Jupp betont „No go“ abwechselnd mit Doppel-O wie in Logo oder mit zweifachem U wie in Uhu.
Ein paar Definitionen vorab
Am Beginn dieser Kolumne kommen wir nicht drum herum, uns mit ein paar Definitionen vertraut zu machen. Was genau ist eigentlich eine No go Area?
Der Begriff stammt aus dem militärischen Sprachgebrauch und bezeichnet eine Zone, die vom Feind kontrolliert wird und deshalb nicht betreten werden kann … in Deutschland sind es Gebiete, in denen Menschen aufgrund ihrer äußeren Erscheinung einem hohen Risiko rassistisch motivierter Gewalt ausgesetzt sind
(c) Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung
Örtlichkeiten mit (angeblich) rechtsfreien Räumen und mit (gefühlt) erhöhter Kriminalität
(c) Wikipedia
Stadtteil/ Bezirk, in dem es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, und wo die öffentliche Sicherheit nicht gewährleistet ist
(c) Duden
Was um Himmelswillen ist nun wieder ein rechtsfreier Raum? Hier liefert Wikipedia folgende Erklärung:
Ein räumlich begrenzter Bereich, in dem keine Gesetze wirken, vorhanden sind, beachtet oder durchgesetzt werden. Als Synonym wird auch von Angstraum gesprochen.
Vor meinem geistigen Auge erscheinen Bilder von Straßenschlachten in Harlem, Bandenkriegen in Rio de Janeiros Armenvierteln oder die Szene, als Snake Plissken im hermetisch abgeriegelten Manhattan gegen eine Armee Outlaws kämpft. Und so was soll es neuerdings auch in unserer beschaulichen, überregulierten Bundesrepublik, dem Land mit der höchsten Politessendichte weltweit, geben? Falls ja: wo?
Exkursion 1: Bad Godesberg
»Schau nach Godesberg!«, rufen Sie mir zu? »Da traut sich kein anständiger Bürger mehr hin.« Also schaue ich über den Rhein, erblicke die Godesburg im abendlichen Dämmerlicht und beschließe spontan, einen kleinen Ausflug ins Bonner Hochrisikogebiet zu unternehmen. Da es bereits viertel nach neun ist, und die letzte Fähre um 21 Uhr ablegt, nehme ich den Weg über die Bonner Südbrücke und gelange gegen kurz nach halb zehn ins Zielgebiet. Ich parke meinen Wagen in einer kleinen, von herrschaftlichen Villen links und rechts gesäumten Straße und spaziere ins Zentrum. Es ist ruhig.
Bonns größtes Kino befindet sich hier. In dessen Eingangsbereich lümmeln ein paar Jugendliche, rauchen, nuckeln an Dosenbier, hin und wieder weht ein Lachen zu mir rüber. Die früher mondäne Fußgängerzone ist nach dem Wegzug der Diplomaten nicht mehr ganz so mondän, wirkt allerdings alles andere als runtergekommen. Ein lauer Frühlingsabend. Die Straßencafés sind gut gefüllt. Bisher das mir seit Jahrzehnten vertraute, friedliche Godesbergbild. Wo sind die Banden, die das Viertel in Angst und Schrecken versetzen? In der Zeppelinstraße die Polizeiwache. Ein rechtsfreier Raum, in dem die Polizei eine große Dependance unterhält? Wie geht das zusammen? Verlassen die Beamten das Gebäude nicht?
Ich stoppe am Alibaba-Grill, bestelle einen Dönerteller mit Salat, keine Fritten. Während ich warte, schaue ich mich um: ein halbes Dutzend arabisch anmutender junger Männer, die Tee trinken, drei Frauen in Burka mit Sehschlitzen, die am Nachbartisch sitzen. Wirken fremdländisch. Klar. Aber nicht Gefahr ausströmend.
Zwischenfazit Godesberg an einem Donnerstagabend im Mai: ruhig mit Tendenz hin zu schläfrig. Die bösen Jungs sind entweder alle zu Hause und zocken an der Playstation oder befinden sich auf einer Fachtagung für Kleinkriminelle in der Nachbarstadt.
Exkursion 2: Köln-Ehrenfeld
»Dann fahr nach Köln! Dort wirst du dein blaues Wunder erleben. Domplatte und so«, sagen Sie jetzt, nachdem sich Godesberg als Reinfall entpuppt hat? Okay, dann tue ich Ihnen den Gefallen und mache mich auf den Weg gen Norden. Ist ja über die A555 ein Katzensprung. Die Gegend um das Kneipenviertel in Ehrenfeld sei supergefährlich? Ich stoppe Freitagabend in der Lichtstraße. Viele Menschen unterwegs. Die Hälfte davon vermutlich nicht mehr nüchtern. Einige sogar sehr angetrunken. Da gibt’s bestimmt gleich ne Massenprügelei, meinen Sie? Ich muss Sie enttäuschen. Bisher bleibt alles im grünen Bereich. Allerdings wurde hier geschlägert, seitdem ich denken kann. Bin zufälligerweise ein paar Blocks entfernt aufgewachsen. Meine Mutter ermahnte mich häufig, dass ich mich von dieser Straße – vor allem in den Abendstunden – fernhalten solle. »Du fängst dir da sonst eine Tracht Prügel ein«, sagte sie. Dasselbe galt für den Park, in dem ich nachmittags mit ein paar Kumpels Fußball spielte. Nach Einbruch der Dunkelheit verwandelte der sich tatsächlich in einen dunklen Angstraum, in dem dunkle Gestalten ihren dunklen Geschäften nachgingen. Und diese Gestalten sprachen oft tiefes Kölner Platt, was auf einheimische Ganoven schließen ließ. Wenn ich heute durch Ehrenfeld und Kalk, auch die früher übel beleumundeten Straßen, laufe, kommen mir die beiden Viertel sehr viel friedlicher vor als in der Zeit meiner Jugend. Was ist mit Domplatte, Wiener Platz und Chorweiler, fragen Sie? Was soll da sein? Im Umfeld des Doms kann es passieren, dass Ihnen ein Taschendieb die Brieftasche klaut, am Wiener Platz wird gedealt und in Chorweiler werden schon mal Autos geknackt und Müllcontainer angezündet. Aber Gefahr für Ihre bürgerliche Gesundheit besteht in allen bisher aufgezählten Gebieten wirklich nicht.
Das Risiko, abends beim Spiegeleibraten mit der linken Gesichtshälfte an der heißen Herdplatte kleben zu bleiben, ist um einiges größer, als in Ehrenfeld, Kalk oder Chorweiler ausgeraubt, niedergeknüppelt oder vergewaltigt zu werden.
Zwischenfazit Köln: Die Stadt wirkt weitaus friedlicher, als es uns Boulevardblätter und aufgeregte Facebookschreiber Glauben machen wollen. Es gibt gefährliche Orte – gemäß NRW-Innenministerium sind es 13 –, aber deren Existenz ist zum einen ein alter Hut und zum anderen besteht auch in denen keine akute Lebensgefahr. Dass auf den Ringen am Wochenende Party gefeiert und vor mancher Kneipentür gerauft wird, ist nun wahrlich nichts Neues.
Exkursion 3: Duisburg-Marxloh
Wir wechseln die Stadt, machen uns auf ins dritte Hochrisikogebiet – Marxloh im Duisburger Norden – und lassen einen Anwohner berichten:
„Vor einigen Jahren konnte ich noch darüber schmunzeln, wenn man mich fragte, ob ich nicht Angst hätte, nach Marxloh zu fahren, um meinen ‚Stammtürken‘ auf der Weseler Straße, die Magistrale des Viertels, zu besuchen. Heute machen mich solche Fragen nur noch wütend. Allerorts wird vor dieser angeblichen No-Go-Area gewarnt, besonders in den sozialen Netzwerken tummeln sich vermeintliche Experten, die sich beim Faktencheck als Provinzprinzen ohne Kenntnisse entpuppen.
Romantisieren sollte man dieses Viertel nicht – ja, es ist ein sozialer Brennpunkt. Während in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts dort noch Manager und Abteilungsleiter umliegender Hüttenwerke wohnten, zogen in den 60er und 70er Jahren viele Gastarbeiter in dieses Viertel, prägten es ebenso wie die Alteingessenen, brachten mit ihren Gemüseläden, Restaurants und Teestuben ein wenig Heimat in den Pott. Der soziale Abstieg begann mit den Schließungen der Zechen und Krupp. Menschen verloren ihre Arbeit, Perspektiven und ihre Hoffnungen und wurden von der Politik vergessen. Einst Arbeiterviertel, prägen heute Arbeitslosigkeit und Armut das Bild, zusätzlich kommen erschwerend die unsäglichen Mythen von der No-Go-Area und den marodierenden Ausländerclans hinzu. Ich kenne Marxloh seit 30 Jahren, habe 20 Jahre meines Lebens im Duisburger Norden, auch Marxloh, verbracht und gewohnt. Nie habe ich mich unsicher gefühlt, nie hatte ich Angst um meine weiblichen Begleitungen, nie kam es zu Übergriffen durch bewaffnete Banden, denn es ist nicht gefährlicher als in anderen Großstädten. Natürlich gibt es Kleinkriminelle, natürlich wird auch hier und dort gedealt, kommt es zu Streitigkeiten oder zu Massenaufläufen, wenn es mal einen Unfall oder einen Polizeieinsatz wegen einer Schlägerei gibt – die Menschen dort sehen es als willkommene Abwechslung ihres oft sehr tristen Alltags; sodass sogar ein negatives Ereignis dort zum Event wird. Aber No-Go-Area? In welcher No-Go-Area der Welt gibt es Polizeistationen, ist das Ordnungsamt mit Knöllchenschreiben aktiv, sind unzählige tolle Restaurants und noch kleine familiengeführte Lädchen, wo jeder, ob Migrant oder Deutscher, freundlich bedient wird? In welcher No-Go-Area siedeln sich Filialisten wie Media Markt, Deichmann und Co an?
Milch und Honig ist es wahrlich nicht, mit der europäischen Öffnung nach Osteuropa und dem Zuzug von Bulgaren und Rumänen kamen zusätzliche Probleme ins Viertel – von den Sprachproblemen der neuen Mitbürger, über Immobilienhaie die sich mit überbelegten Wohnungen eine goldene Nase verdienen bis zu Scheinselbständigkeiten im Niedriglohnbereich. Diese Probleme gilt es zu bewältigen, es ist aber nicht abzusehen, dass die Politik, die die Stigmatisierung und die damit verbundenen Probleme für dieses Viertel über Jahrzehnte gekonnt ignoriert hat, dies wirklich will und kann.
So werde ich mich auch in Zukunft über Fragen ärgern und in Zeitungen und in den sozialen Netzwerken lesen müssen, von Menschen die es nur vom Hörensagen kennen, wie gefährlich es dort ist. Aber dass dies ein Schlag ins Gesicht derer ist, die dort täglich etwas bewirken (wollen), sozial engagiert sind und es die Existenzgrundlage meines Stammtürkens und der vielen anderen Geschäftsleute entziehen kann, weil sie um jeden Gast und gegen all die Vorurteile ankämpfen müssen, wird die Provinzprinzen, Schubladendenker, Schwarzseher nicht interessieren, denn nach unten treten ist so viel einfacher als offen und engagiert zu agieren.“
© Daniel Patrick Burgdorf
Zwischenfazit Marxloh: Der Döner beim Stammtürken ist heißer als die Atmosphäre draußen auf der Straße.
Exkursion 4: Berlin-Neukölln
Nun ein weiter Sprung Richtung Nordosten in den kriminellen Abgrund Berlins – Neukölln –, wo der rechtsfreie Raum mittlerweile so groß ist, dass er droht, die gesamte Hauptstadt zu verschlingen.
Und wieder berichtet ein Anwohner:
„Neukölln hat ein gewisses Image und wird gerne „No Go-Area genannt, in die sich angeblich die Polizei nicht mehr hintraut. Das ist aber mehr oder weniger eine subjektive Wahrnehmung, die eher absurd ist. Und als „ewiger Neuköllner“ muss ich darüber oft schmunzeln.
Nimmt man als Beispiel den Hermannplatz, der ja gerne als besonderer Kriminalitätsschwerpunkt genannt wird, weiß eigentlich jeder, der dort schon mal nachts war, dass dort eigentlich eine nahezu dauerhafte Polizeipräsenz in Form eines Mannschaftswagens vorhanden ist.
In anderen „verrufenen Zonen“ befinden sich Polizeireviere. Beispielsweise Abschnitt 54 auf der Sonnenallee, Abschnitt 55 in der Rollbergstraße, direkt zwischen Karl-Marx-Straße und Hermannstraße.
Damit ist die Legende von der angeblichen „No-Go-Area, in die sich die Polizei nicht traut“ also eigentlich schon widerlegt, denn ausgerechnet in dieser Zone ist die Polizei stark präsent. (Und kommt deshalb auch logischerweise relativ schnell, wenn sie gerufen wird).
Da ich mich kurz fassen sollte: Die vermeintlichen No-Go-Areas in Berlin sind eigentlich lediglich kriminalitätsbelastete Orte. Und diese Bezeichnung der Polizei erhalten Sie durch unterschiedliche Straftaten. Orte wie die U-Bahnhöfe Hermannplatz in Neukölln, oder Kotbusser Tor in Kreuzberg haben starken Drogenhandel, da sie Verkehrsknotenpunkte sind, Orte wie die Warschauer Brücke und das RAW-Gelände in Friedrichshain, aber ganz besonders der Alexanderplatz, sind wegen der hohen Frequentierung durch Touristen und Partygänger bei Taschendieben sehr populär.
Der große Witz ist, dass gerade diese Orte eben speziell am Wochenende eher Go- als No-Go-Gebiete sind.
Es ist eine Legende, dass man dort ständig überfallen und ausgeraubt wird. Natürlich gibt es dort Raubüberfälle, aber speziell Schlägereien und Drogenhandel oder Bandenkriminalität betreffen meist keine Außenstehenden.
Solche Vorfälle wie der „U-Bahntreter von der Hermannstraße“, der dann monatelang in den Medien herhalten musste, sind eben deshalb spektakulär, weil sie tatsächlich, gerade gemessen an der Zahl der Menschen, die dort alltäglich unterwegs sind, nicht häufig vorkommen.
© Freddy Groeger im Mai 2018
Zwischenfazit Neukölln: Die Polizei ist schneller vor Ort als in vielen gutsituierten Wohngegenden.
Wer profitiert vom Geschwätz über No-Go-Areas?
Nachdem die Exkursion in vier Hochrisikogebiete, deren bloße namentliche Erwähnung die Hälfte der Facebookleser nicht ruhig durchschlafen lässt, bei den Reisenden keine bleibenden Schäden an Leib und Seele hinterließ, kann aufgrund dieser – zugegebenermaßen kleinen – Stichprobe durchaus der Schluss gezogen werden, dass es No go Areas in Deutschland nicht gibt. Von der Existenz rechtsfreier Räume, in die sich die Polizei nicht hineintraut, sind ohnehin nur die Zeitgenossen überzeugt, die v. Dänikens Spekulationen über die Präsenz außerirdischen Lebens auf unserem Planeten für seriöse Wissenschaft halten.
Es wird natürlich nicht in Abrede gestellt, dass täglich Gewalttaten – auch in den o.g. Bezirken – verübt werden. Die Frage ist aber, ob die sich an einem bestimmten Ort derart häufen, dass man diesen mit Fug und Recht als Angstraum titulieren kann. Reviere, die man nur als Lebensmüder betritt. Und hier kommt eine weitere Unschärfe des No-Go-Area-Begriffs zutage. Denn es sind ja nie gesamte Stadtviertel betroffen, sondern allenfalls kleine Areale innerhalb einzelner Gebiete. Zumeist eine dunkle Straße, Ecke, Bahnunterführung, in/ an der gedealt oder vor Kneipentüren geschlägert wird. Das sind aber nun echt uralte Kamellen. Gab es bereits im Köln meiner Kindheit und Jugend und vermutlich auch schon davor. Ich kann mich sowieso des Eindrucks nicht erwehren, dass es heutzutage in vielen Städten sehr viel friedlicher zugeht als in den 60ern und 70ern, als man häufig Gefahr lief, eine aufs Maul zu bekommen, wenn man sich dummerweise zur falschen Uhrzeit am falschen Ort aufhielt.
Wenn also No-go-Areas in Deutschland nicht existieren – welchem Zweck dient es, den Begriff dennoch inflationär zu verwenden?
Mir kommen zwei Erklärungen in den Sinn:
(1) Im Land der Gelbe-Westen- und Fahrradhelm-Träger fällt das Thema „mangelhafte Sicherheit“ stets auf einen lüsternen Resonanzboden. Es befeuert Ängste und Phobien, steigert Zeitungsauflagen und die Umsätze von Firmen, die Alarmanlagen und einbruchsichere Haustüren verkaufen. Es dient Politikern dazu, immer strengere Überwachungsregeln zu fordern und unsere individuellen Freiheiten häppchenweise einzukassieren. Und das nicht in Köln, Godesberg, Marxloh oder Neukölln wohnende Publikum fläzt sich zu Hause auf dem Sofa, während es in den RTL-Nachrichten mal wieder voyeuristisch einem Gruselbericht über Massenprügeleien im Ehrenfelder Kneipenviertel lauscht, bevor es zur Vorabendserie in Pro 7 weiterzappt.
(2) Der im Vorfeld der WM 2006 als Reisewarnung für dunkelhäutige Menschen eingeführte Begriff soll nun umgewidmet werden in Gefahrenzonen, die für die weiße Mehrheitsbevölkerung nicht mehr betretbar sind. Weil von libanesischen, ghanaischen, ivorischen – Hauptsache exotisch klingenden – Clans regiert. Komischerweise verspürt aber niemand Angst, wenn er eine Pizzeria betritt, die Abgaben an die Camorra zahlt. Es ist die übliche Begriffsverwirrung durch die Rechten, die ja auch die Faschisten rotlackiert auf der linken Seite verorten und behaupten, dass die Nazis primär Sozialisten waren. So was nennt man: Desinformation.
Als Fazit bleibt festzuhalten: die Bundesrepublik ist eines der sichersten Länder weltweit. No Go Areas gibt es nicht. Die Gewalt-Fallzahlen sind seit Jahren rückläufig. Wer ständig von Panikattacken geritten wird, wenn er an Godesberg, Ehrenfeld, Marxloh und Neukölln denkt, obwohl es an diesen Orten genauso beschaulich zugeht wie in seiner eigenen Nachbarschaft, muss zum Psychologen. Diejenigen, die wider besseren Wissens von No-Go-Bezirken sprechen, wollen damit ihr eigenes – zumeist xenophobes – Süppchen am Kochen halten.
P.S. Das ganze No-Go-Gequatsche hält Jupp übrigens nicht davon ab, wöchentlich drei Mal mit der kleinen Fähre von Dollendorf nach Godesberg überzusetzen, denn seine Lebensgefährtin Nummer 27 lebt dort. Das ist aber wieder eine neue Geschichte.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



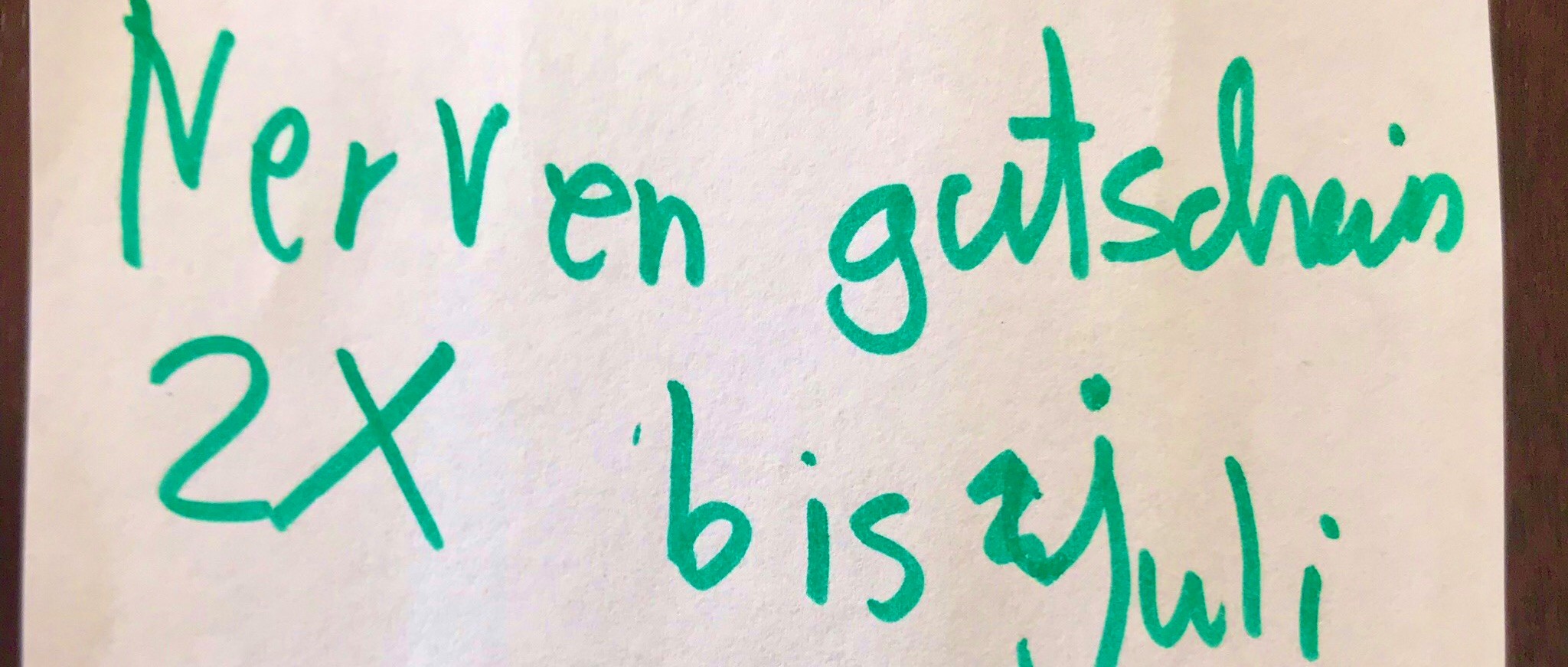

Ellen Wortmann
Hieß schon vor meiner Kinderzeit: „Alles Böse dieser Welt, kommt aus Nippes, Kalk und Ehrenfeld“ oder eher “ Alles Böse dieser Welt, kütt us Neppes, Kalk un Ihrefeld“. Also, nichts Neues unter der Sonne.