Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: Bei der Notrufzentrale geht ein Anruf ein: Eine Patientin hat die 112 gewählt, weil sie nicht mehr auf den Beinen stehen kann und das Gefühl hat, ohnmächtig zu werden. Sie schicken den Rettungsdienst zur Wohnung der Patientin. Der Rettungsdienst kommt zuhause bei der Patientin an und findet diese inzwischen nicht mehr ansprechbar vor. Die Mitarbeiter der Notrufzentrale sind aber in die elektronische Patientenakte eingeloggt und verfügen so über alle relevanten Informationen der Patientin. Die Rettungssanitäter nehmen die Patientin mit in die Notaufnahme des Krankenhauses. Dort stoßen die Ärzte in der elektronischen Patientenakte auf folgende Einträge: Sie hat seit Jahren einen seltenen Tumor und vor Kurzem eine Kortisonbehandlung bekommen. Es wird eine Blutentnahme und eine Computertomographie durchgeführt, um der Ursache auf den Grund zu kommen.
Bundestag beschließt zahlreiche Neuerungen zur elektronischen Patientenakte
Da der seltene Tumor schon Jahre alt ist, ist es unwahrscheinlich, dass dieser zum akuten Zustand der Patientin geführt hat. Eine Kortisonbehandlung kann jedoch zu einer sogenannten Nebennierenkrise führen, ebenfalls eine seltene Erkrankung. Dabei handelt es sich um einen lebensbedrohlichen Zustand, in dem der Körper nicht mehr in der Lage ist, wichtige Prozesse zu regulieren wie beispielsweise den Elektrolyten- und Wasserhaushalt. Die Blutentnahme bestätigt den Verdacht: Die Patientin hat aufgrund der Nebennierenkrise eine schwere Elektrolyten-Entgleisung mit gleichzeitiger Wasservergiftung erlitten, die im Krankenhaus notfallmedizinisch mit einer Infusion korrigiert werden müssen. Gut, dass in der elektronischen Patientenakte die aktuelle Medikamentierung sowie der alte Tumor registriert sind. So kann die Patientin trotz der seltenen Erkrankungen sofort richtig diagnostiziert, therapiert und letztlich ihr Leben gerettet werden.
„Der Bundestag hat am Donnerstag, 14. Dezember 2023, diverse Neuerungen im Hinblick auf die elektronische Patientenakte (ePA) beschlossen“, so heißt es auf der Seite des Deutschen Bundestages. Ab 1. Januar 2024 soll das elektronische Rezept verbindlich und für gesetzlich Versicherte ab 2025 die elektronische Patientenakte angelegt werden, es sei denn diese widersprechen aktiv. In der elektronischen Patientenakte sollen dann nach Möglichkeit alle Befunde, Therapien und Medikamentierungen ab Geburt registriert werden. Damit könnten gefährliche Wechselwirkungen von Medikamenten vermieden, seltene Erkrankungen viel schneller erkannt und so letztlich Leben gerettet werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach spricht in der Schlussberatung von einem Quantensprung in der Digitalisierung und im Gesundheitssystem insgesamt. Die Gesundheitsdaten seien derzeit auf verschiedene Einrichtungen verteilt, was zu Doppeluntersuchungen und Fehldiagnosen führe.
Was geschieht mit ärztlicher Schweigepflicht und eventuell doch notwendiger Zweitmeinung?
Dass die Gesundheitsdaten derzeit auf verschiedene Einrichtungen verteilt sind, hat einen Grund: Die ärztliche Schweigepflicht, zu der sich der Arzt mit seinem hippokratischen Eid verpflichtet hat. Diese gewährleistet, dass die Arztgespräche in den Räumlichkeiten des Arztes verbleiben. Die Schweigepflicht gilt auch gegenüber dem Staat oder anderen Ärzten, soweit der Patient den Arzt nicht von seiner Schweigepflicht entbunden hat. Nur so kann das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient gewahrt werden. Verstößt der Arzt gegen seine Schweigepflicht, macht er sich gemäß § 203 StGB strafbar. Einträge in die elektronische Patientenakte, die sowohl für staatliche als private medizinische Einrichtungen einsehbar sind, stellen daher grundsätzlich eine Verletzung des § 203 StGB dar. Der Patient muss darauf vertrauen können, dass die Gespräche mit seinem Arzt vertraulich bleiben, damit er offen über die sensibelsten Angelegenheiten im Rahmen seiner Gesundheit sprechen kann. Die Versicherten sollen deswegen der Speicherung in der elektronischen Patientenakte aktiv widersprechen können.
Ferner soll eine Sammlung in der elektronischen Patientenakte im Rahmen der Gesetzgebung zur Digitalisierung im Gesundheitswesen für Gemeinwohlzwecke möglich sein. Natürlich kann es im Rahmen der Forschung sinnvoll sein, Gesundheitsdaten zu sammeln. Dennoch ist dies nicht unproblematisch. Vergleichen wir das Arzt-Patienten-Verhältnis einmal mit dem Anwalt-Mandantenverhältnis. Das Mandantengespräch ist ebenfalls durch § 203 StGB geschützt. Niemand kommt hier aber hoffentlich auf die Idee, dass das Mandantengespräch mit dem Strafverteidiger zentral gespeichert werden sollte, damit die Strafverfolgung erleichtert werden kann und so im Sinne des Gemeinwohls eventuell weitere Straftaten verhindert werden können.
Wenn der Bundesgesundheitsminister über Vermeidung von „Doppeluntersuchungen“ und „Fehldiagnosen“ durch Speicherung in der elektronischen Patientenakte spricht, erklärt er damit im Prinzip dass eine einmal vorgenommene Facharztuntersuchung die in der Patientenakte registriert ist, richtig ist und ein zweiter Facharzt derselben Richtung nicht noch einmal untersuchen und gegebenenfalls eine andere Therapie anwenden sollte. Aus dem ärztlichen Behandlungsvertrag schuldet jedoch jeder Arzt dem Patienten eigenverantwortlich Anamnese, Diagnose und Therapie. Deswegen kann es sich letztlich um einen Behandlungsfehler handeln, wenn der zweitaufgesuchte Arzt nun nicht mehr tätig wird, um eine „Doppeluntersuchung“ zu vermeiden oder eine Diagnose zu stellen, die der ersten widerspricht. Dabei ist es gerade bei seltenen Erkrankungen oftmals notwendig, verschiedene Meinungen von Spezialisten einzuholen und „Doppeluntersuchungen“ durchzuführen um eine korrekte Diagnose zu bekommen.
Angeblicher Vorteil = E-Rezept bei Auslandsaufenthalt
Mit dem elektronischen Rezept soll dann in Zukunft auch ein Bezug von Medikamenten im Ausland möglich sein, wenn man zum Beispiel im Urlaub ist. Wie schön wäre es, wenn das E-Rezept hierzu beitragen würde. Ich kann aus Erfahrung sagen: Im Regelfall liegt es nicht am fehlenden Rezept, sondern an der Tatsache dass es das Medikament im anderen EU-Land gar nicht gibt. Auch kann es aufgrund von Geoblocking dann nicht online über die Grenze bestellt werden. Krankenkassen übernehmen Kosten für das Aufsuchen eines Arztes im EU-Ausland auch nur dann, wenn es sich um einen Notfall handelt. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es die Möglichkeit, mit meiner Krankenversichertenkarte unbürokratisch und überall in der Europäischen Union den Arzt meines Vertrauens aufsuchen zu dürfen und die mir vorgeschriebenen Medikamente in jedem EU-Land beziehen zu können. Die grenzüberschreitende Datensammlung auf der einen Seite mit solchen praktischen Beschränkungen auf der anderen Seite tragen aus meiner Sicht nicht zur Verbesserung des Gesundheitswesens bei.
„Deutsche und ihr Datenschutz“
Ich lebe in den Niederlanden und hier ist die elektronische Patientenakte schon seit 2008 der Standard. Unter der sogenannten Bürgerservicenummer werden unter anderem Daten von sämtlichen medizinischen Einrichtungen zusammengeführt. Daten können unter der Bürgerservicenummer bis zur Geburt zurückverfolgt werden. Die Aufbewahrungsfrist für die elektronische Patientenakte beträgt 20 Jahre. Wenn ich die ärztliche Schweigepflicht oder Datenschutz erwähne, werde ich belächelt: „Jaja, Deutsche und ihr Datenschutz.“ Natürlich kenne ich das Totschlagargument gegen Datenschutz bzw. ärztliche Schweigepflicht und für die elektronische Patientenakte aus Gesprächen mit den Niederländern: „Was wenn du einen Unfall hast, du nicht ansprechbar bist und der Arzt braucht Informationen um dich zu retten?“
Kommen wir zurück zu dem anfangs beschriebenen Szenario. Dieses Jahr ist es mir passiert: Ich war aufgrund einer seltenen Erkrankung nicht mehr ansprechbar und die Rettungssanitäter und Ärzte konnten sämtliche Informationen in meiner niederländischen elektronischen Patientenakte einsehen. Die ersten Einträge in der elektronischen Patientenakte waren der alte Tumor und die aktuelle Kortisongabe. Zum Glück konnten meine seltenen Erkrankungen aufgrund der vorliegenden Daten – die fast 20 Jahre zurückreichten – schnell diagnostiziert und therapiert werden. Oder doch nicht?
Praxistest -> gespeicherte Daten führten nicht zur richtigen Diagnose
In der Realität lief das oben beschriebene Szenario anders ab: Trotz der Informationen in der elektronischen Patientenakte wurde die Ursache der Elektrolyten-Entgleisung nicht erkannt. Die Blutentnahme und die Computertomographie hätten aufgrund des Tumors anders durchgeführt werden müssen. Kortison und Tumor waren die ersten Einträge in der elektronischen Patientenakte und dennoch wurde nicht entsprechend gehandelt. Der immer erwähnte Notfall, bei dem man nicht mehr ansprechbar ist, war eingetreten. Die elektronische Patientenakte hat jedoch nicht dazu beigetragen, dass die seltenen Erkrankungen richtig diagnostiziert und deswegen mein Leben gerettet wurden. Mein Leben habe ich einer Menge Glück zu verdanken. Aus meinem niederländischen Umfeld erhalte ich nun Reaktionen, dass es im Einzelfall halt ab und an zu Fehlern kommen kann. Genau diese Fehler zeigen aber Folgendes: Nicht die elektronische Patientenakte ist im Notfall entscheidend, sondern die Sorgfalt der behandelnden Ärzte bei der Anamnese, der Diagnosestellung und der Therapie. Die lebensrettenden Informationen können den Ärzten natürlich in einer elektronischen Akte zur Verfügung gestellt werden. Es geht aber auch über einen Medikamentenausweis oder schlicht einen Zettel, den der Patient mitführt, auf dem die Notfallmedikamente aufgelistet sind. Jede Rettungskraft und jeder Arzt können auf ein solches Dokument im Notfall schnell zugreifen, ohne sich zuvor in ein System einloggen zu müssen. Ganz klassisch analog.
+++
Nicole Krey
Gebürtige Bonnerin, aufgewachsen in den Niederlanden. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und anschließender Tätigkeit als Anwältin in Düsseldorf ist sie inzwischen als Unternehmensjuristin im digitalen Bereich tätig und wohnt wieder an der niederländischen Küste. Als Angehörige der Generation X hat sie in den 90ern auf einem 386er noch über MS-DOS prompt Befehle eingegeben, sich mit Unbekannten in Chatrooms über Musik ausgetauscht und Partys ohne Smartphone gefeiert.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.
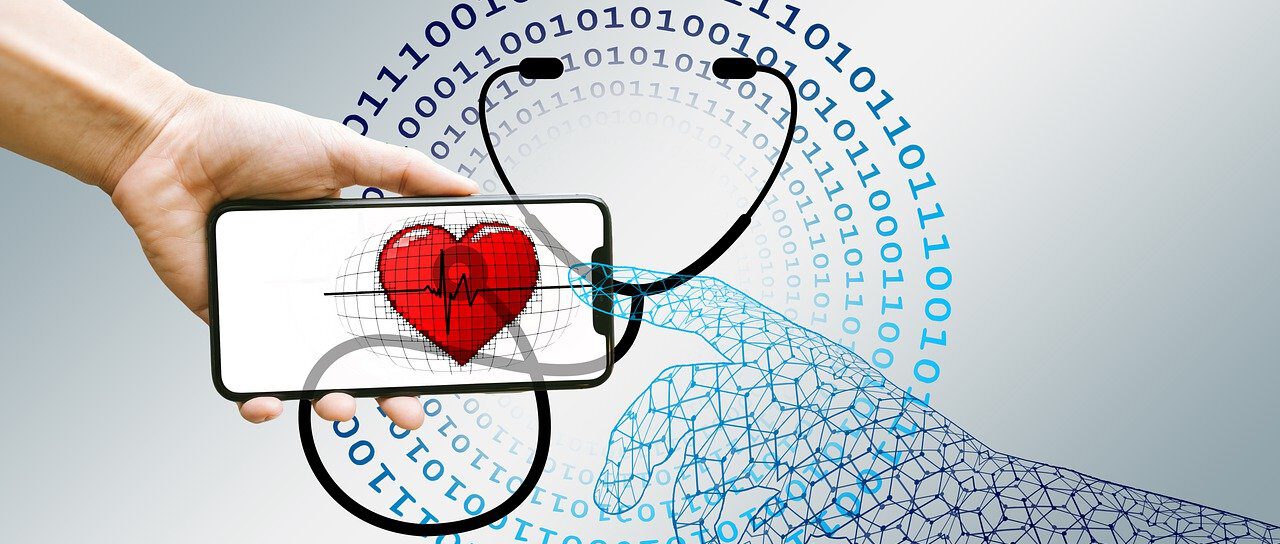




Ihr Kommentar